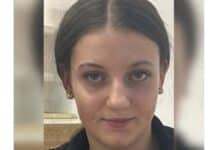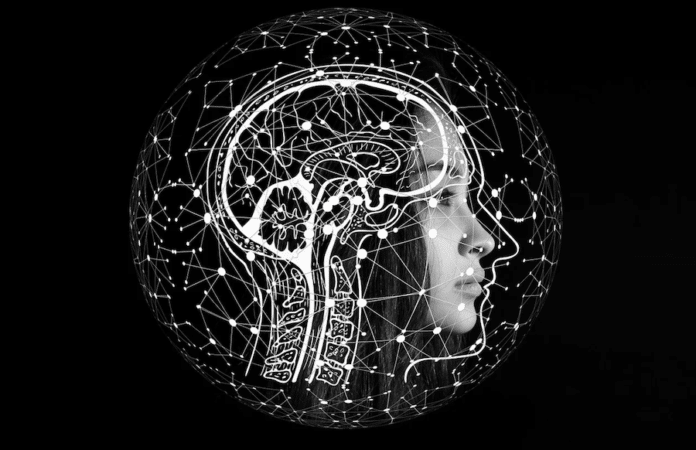Mittlerweile vergeht keine Woche mehr, in der nicht über das Thema künstliche Intelligenz (KI) berichtet wird. Von Fortschritten in der Medizin über den oft unerwünschten Einsatz in Schulen bis hin zu gefährlichen Entwicklungen im militärischen Bereich reichen die Anwendungsfelder. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die größten Fortschritte in den letzten Jahren erzielt wurden.
Von Science-Fiction bis zu den notwendigen Theorien
Mit dem Aufkommen des Films fand die Vorstellung lebendiger Maschinen zunehmend Einzug in Kino und Fernsehen. Ein markantes Beispiel für die frühe Darstellung künstlicher Intelligenz auf der Leinwand ist der Science-Fiction-Stummfilm „Metropolis“ aus dem Jahr 1927, der auf einem gleichnamigen Roman basiert. Dieser Film entwirft das Bild einer düsteren Zukunft, in der Menschen von Androiden beherrscht werden. Laut ExpressVPN reiht sich der Film in eine Liste von wahr gewordener Science-Fiction ein.
Von der bloßen Idee dauerte es nicht lange zu den notwendigen mathematischen Theorien für eine Umsetzung. Der britische Mathematiker Alan Turing zeigte 1936 mit seinen Theorien, dass eine Rechenmaschine, die sogenannte „Turingmaschine“, in der Lage sein könnte, kognitive Funktionen auszuführen, sofern diese Funktionen in Einzelschritte zerlegt und algorithmisch dargestellt werden können. Dies ebnete den Weg für das, was heute als künstliche Intelligenz bekannt ist.
1956 – die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz als Begriff
Im Jahr 1956 führte John McCarthy den Begriff der künstlichen Intelligenz ein, während einer von ihm organisierten Konferenz am Dartmouth College. Ziel dieser Konferenz war es, Wege zu erforschen, wie Maschinen das menschliche Sprachvermögen nutzen, menschlichen Problemlösungen nachgehen und sich selbstständig verbessern könnten. Obwohl die Konferenz keine unmittelbaren Durchbrüche hervorbrachte, spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Festigung von KI als eigenem Wissenschaftszweig. Einflussreiche Forscher der Konferenz, darunter Marvin Minsky und Claude Shannon, prägten das Feld der künstlichen Intelligenz in der Folgezeit maßgeblich.
Der erste Chatbot und der anschließende KI-Winter
1966 entwickelte Joseph Weizenbaum, ein deutsch-amerikanischer Informatiker am Massachusetts Institute of Technology, „ELIZA“, ein Computerprogramm, das die Kommunikation mit Menschen nachahmte. Durch vordefinierte Skripte konnte „ELIZA“ unterschiedliche Konversationsrollen übernehmen, etwa die eines Psychotherapeuten. Weizenbaum selbst war erstaunt darüber, wie einfach es „ELIZA“ fiel, die Illusion eines menschlichen Dialogpartners zu schaffen.
Von den späten 1960er bis in die 1970er Jahre gab es eine Periode, die als KI-Winter bezeichnet wird. In dieser Zeit ging das Interesse an künstlicher Intelligenz deutlich zurück und viele Forschungsinitiativen in diesem Bereich wurden eingestellt. Diese Entwicklung hatte verschiedene Ursachen. Die ersten Erfindungen und Fortschritte weckten übertriebene Erwartungen. Noch Anfang der 1970er Jahre glaubten einige Wissenschaftler, dass Maschinen innerhalb von zehn Jahren menschliche Intelligenz erreichen würden. Für komplexe Aufgaben wie Spracherkennung oder Bildverarbeitung waren die damaligen Computer aber noch nicht weit genug entwickelt.
Wie Deep Blue und das Internet die Entwicklungen beflügelten
Ein Meilenstein wurde am 11. Mai 1997 erreicht, als der IBM-Computer Deep Blue den amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte. Deep Blue nutzte hauptsächlich Ansätze der symbolischen KI, einschließlich einer umfangreichen Datenbank von Eröffnungszügen und der Bewertung von Spielsituationen, um Züge vorherzusagen.
Die Entstehung des World Wide Web und Fortschritte im Telekommunikationssektor erleichterten in den 2000er Jahren die Übertragung und Speicherung großer Datenmengen. Diese Entwicklungen bildeten die Grundlage für den Aufschwung der Forschung an neuronalen Netzen und Deep-Learning-Algorithmen, der durch die Verfügbarkeit von Big Data beflügelt wurde. In den folgenden Jahren entstanden immer mehr Softwarelösungen, die auf der Auswertung und Nutzung großer Datenmengen basieren.
Im November 2022 stellte das kalifornische Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT vor und löste damit einen enormen Hype um generative künstliche Intelligenz aus. ChatGPT wurde mit umfangreichen Textdaten trainiert, die größtenteils aus dem Internet stammten. Nach der öffentlichen Freigabe des Systems registrierten sich innerhalb von nur fünf Tagen mehr als eine Million Nutzer. Im Umfeld von ChatGPT entstanden weitere generative KI-Anwendungen und -Dienste für unterschiedlichste Anwendungsbereiche und Nutzungsszenarien. Inzwischen sind KIs verfügbar, die nicht nur lernen, sondern auch andere KIs anleiten können.